Ich weiß gar nicht, wann das anfing, mit mir und Facebook schwierig zu werden. Es muss irgendwann im vergangenen Jahr gewesen sein, als in den sozialen Netzwerken und in den Kommentarspalten der Onlinemedien all die fremdenfeindlichen Statements auftauchten und ich erst erstaunt, dann wütend und irgendwann resigniert vor dem Rechner saß. Meinem Verhältnis zu Facebook hat das einen gehörigen Knacks versetzt, denn ich konnte gar nicht verstehen, wie das Unternehmen es zulassen konnte, dass derart beleidigend gehetzt und getrollt wurde, dass falsche Unterstellungen und Gerüchte so ungefiltert in die Welt hinausblubbern und sich irgendwann verselbständigen, losgelöst von jeglicher Vernunft und jeglicher Gabe zur Reflexion.
Für mich als Kommunikationswissenschaftlerin ist dieses Web 2.0, das ja vielleicht schon längst ein Web 3.0 oder 4.0 oder x.0 ist, natürlich eine spannende Sache. Denn als ich anfing, mich mit Kommunikationstheorien zu beschäftigen, da gab es das Internet gerade erst ein paar Jahre, man surfte mit dem Netscape Navigator und wählte sich mit einem Modem ins Netz ein, das so laut knackte und krachte, dass man befürchten musste, es würde gleich explodieren. Ein Kommilitone im 2. Semester erzählte mir damals von einem Geheimtipp, einer Suchmaschine namens Google, die „viel besser“ sei als alles andere, was es gäbe, denn sie erziele viel bessere Treffer.
Soziale Netzwerke waren Chats, man erfand so lustige Abkürzungen wie LOL und ROFL und die Coolen hatten bereits ein Handy, meistens einen ziemlich großen Nokia-Knochen. Facebook und Co sollten noch ein paar Jahre brauchen, um zu entstehen. Wenn man jemand kennenlernen wollte, musste man ihn tatsächlich ansprechen und nach seiner Festnetz(!) Nummer fragen. Dann rief man an und landete beim WG-Telefon auf dem Flur, von dem aus dann in der Öffentlichkeit der weiteren WG-Bewohner ein Date ausgemacht wurde.
Vieles ist anders geworden seitdem. Ich nutze all die Kanäle, die es mittlerweile gibt, auch mit durchaus professionellem Interesse und freu mich irgendwie auch öfter drüber, dass ich dabei war, als das alles begann. Die gute alte Zeit. Manchmal vermisse ich sie richtig, ehrlich. Als man noch nicht jeden Kaffee, den man getrunken hat, irgendwo gepostet hat. Als man jemanden anrief, und persönlich mit ihm sprach, wenn man was von ihm wollte. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Facebook und ich: Eine zweispältige Beziehung
Facebook nun also. Lange Zeit mochte ich dieses Netzwerk gerne, und ich tue es ja immer noch, denn ich arbeite immerhin damit, es ist die Plattform, auf der ich Reichweite für meinen Blog und für andere Projekte generiere. Ich mag es, mich mit anderen dort auszutauschen, meine Texte einzustellen und zu sehen, wie meine Leser darauf reagieren. Welche Posts sie mögen, welche nicht so sehr. Ich freue mich über jedes Like und jeden Kommentar. Aber ich nutze es nun anders. Es ist nicht mehr mein wichtigstes Medium, andere Netzwerke wie Instagram sind dazu gekommen (okay, man kann jetzt argumentieren, dass das ja mittlerweile zu Facebook gehört). Aber ich zwinge mich, nicht mehr zu sehr einzutauchen in die Parallelwelt, die sich dort auftut, in der es der Propaganda so einfach gemacht wird, sich in die Welt und die Köpfe hinein zu verbreiten. Abgesehen davon, dass es einfach viel zu viel Zeit frisst.
Sascha Lobo hat vor einiger Zeit im Rahmen seiner Kolumne auf Spiegel Online davon geschrieben, dass man denen, die das Netz in dieser schlimmen, wütend machenden Manier aufmischen, entgegentreten muss. Damit sie es sich nicht zu eigen machen. Ich hab das eine Zeit lang versucht, aber ich muss gestehen, dass ich davon sehr müde geworden bin. Es ist ein bisschen wie Sisyphos. Kommentar folgt auf Kommentar, ändern tut sich wenig. Deswegen poste ich weniger, bin zurückhaltender, kommentiere nicht mehr viel. Schade ist das im Grunde, aber auch irgendwie besser fürs Karma.
Twitter: Lustig sein in Zweizeilern
Derweil probiere ich mich auf den anderen sozialen Kanälen aus. Zu Twitter hatte ich leider immer ein ziemlich gespaltenes Verhältnis, ich bin damit nie richtig warm geworden. In den Anfängen, als ich begann, mich auch beruflich mit Social Media zu befassen, konnte ich mit Twitter irgendwie nichts anfangen. Mir erschien das so belanglos. Es war 2008 und Barack Obama nutzte Twitter für seinen Wahlkampf und plötzlich was es in aller Munde. Ich fand, dass man auf Facebook viel besser seine Messages kommunizieren konnte, schon alleine weil man Bilder, Links und Videos posten konnte.
Twitter blieb für mich immer eine Welt, an der ich nicht teilnahm, weswegen ich ewig nicht mal einen Account dort hatte. Genau genommen hatte ich sogar früher einen Instagram-Account als einen Twitter-Account. Und unser Verhältnis ist immer noch gespalten, liebes Twitter, nicht wahr.
Das Schreiben ist zwar mein Beruf, aber ich kann in diesen zwei Zeilen, die mir Twitter bietet, einfach nicht witzig sein. Ich bin ein Vielschreiber, ich brauche viele Wörter, um mich und meine Texte zu entfalten, so knapp und treffend zu sein, dabei auch lustig und klug – das liegt mir nicht. Und all die Unterhaltungen, die über Twitter geführt werden, quasi ein Ersatz für die Messenger der frühen Netz-Tage, die sind auch nicht so meins. Ich weiß natürlich, dass Twitter das Medium der Stunde für viele meiner Blogger-Kollegen ist, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Aber meine Versuche, mich zu beteiligen sind bislang eher kläglich gescheitert. Auch weil ich irgendwie lieber mit Menschen spreche, als mich stundenlang in Zweizeilern zu unterhalten.
Deswegen kümmert mein Twitter-Account so vor sich hin, und alle paar Wochen bekomme ich einen Rappel und twittere dann ein paar Tweets, was aber natürlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Meine Blogposts erscheinen dort, was gut ist, denn Google mag Twitter, weil Facebook Twitter nicht mag und Google mag Facebook nicht, zumindest habe ich das als eine der Quintessenzen aus einem SEO-Seminar mitgenommen, das ich vor ein paar Wochen absolviert habe.
Der schöne Schein auf Instagram
Ich mag Fotos, ich mache sowieso ständig welche, für den Blog, für meine Projekte, fürs Private, deswegen liebe ich Instagram. Vor ein paar Jahren fiel mir auf, dass meine amerikanischen Freunde bei Facebook immer so coole Fotos posteten und fragte mich, wie die denn diese Effekte auf ihre Bilder bekamen. Siehe da, es war Instagram und das lud ich mir dann auch direkt mal runter. Wenn man sich durch meinen Instagram-Account scrollt, kann man auch direkt sehen, wie sich die Filter, das Design, wie sich das gesamte Instagram im Laufe der Zeit entwickelt hat. Aus dem Foto-Filter, mit dem man seine Bilder aufpimpte, um sie dann auf Facebook zu posten, ist ein eigenständiger Dienst geworden, der sich anschickt, dem großen Bruder langsam den Rang abzulaufen.
Was ich auf Instagram mag: Dort gibt es genau diesen Hass und die Hetze nicht, die Facebook zu sehr flutet, zumindest nicht in dem Ausmaß und nicht auf den Accounts, auf denen ich mich aufhalte. Man ist eher lieb und postet Herzchen und nach oben gereckte Daumen und Peace-Zeichen. Und bekommt unglaublich tolle Bilder zu sehen. Das ist schön und schlimm zugleich. Denn um einen gut aussehenden, wirkungsvollen Account hinzubekommen, muss man viel Arbeit reinstecken. Es ist nicht mehr wie früher, als man mal irgendwas fotografierte und dann einen Filter drüber setzte und fertig. Zumindest nicht, wenn man damit Reichweite generieren möchte.
Und all diese wunderschönen Accounts! Sanfte, pastellige Farben, Interior-Pics wie aus dem Katalog, tolle Essenskreationen, zart dahingehauchte Accessoires, witzige Selfies, all die unglaublichen Bilder von irgendwo auf der Welt: Das sehe ich mir gern an, aber gleichzeitig frustriert es mich auch. Wie bekommen die das hin? Frage ich mich regelmäßig. Sind das alle Leute mit 200 Quadratmeter großen Altbauwohnungen, lichtdurchflutet und eingerichtet mit den allerneusten Design-Möbeln made in Skandinavien? Wie bezahlen die das denn alles? Und die Travel-Leute, die in ihrem Profil ihre nächsten Stationen angeben – „Now: India – Next stops New Zealand, Bali, Costa Rica“ – leben die von ihren Fotos?
Ich gebe zu, es macht mir weniger aus, wenn das professionelle Fotografen sind, denn es ist deren Job, gute Bilder zu machen. Aber all die semi- und weniger professionellen Blogger und Instagramer: Wie schaffen die das, dass das so toll aussieht? Alles immer in weiß und die neuesten Dekotrends und dazu noch (zu Recht!) 20.000 Follower.
Das ist ein wenig wie damals mit den Brigitte Models – erinnert ihr euch noch an die Aktion? Die Zeitschrift hatte vor ein paar Jahren verkündet, dass sie ab sofort keine professionellen Models mehr beschäftigen wird, sondern nur noch Mädchen und Frauen „wie du und ich“. Das Problem an der Sache war dann aber, dass all diese Laien-Models dann trotzdem so fantastisch aussahen und so mega-schlank waren und dann auch immer ich eine total spannende Vita hatten – die Interior Designerin aus Südafrika mit Wohnsitzen in London und auf Island, fotografiert vor ihrem natürlich überaus geschmackvoll eingerichteten Zweit-Cottage in den schottischen Highlands, so etwas in der Art.
Es waren also eben NICHT Frauen wie du und ich, sondern viel coolere und schönere und selbst wenn man wusste, dass auch die stundenlang in der Maske saßen und die Vita natürlich auch ein bisschen geschönt ist, so bekamen doch allzu viele Leserinnen bei der Lektüre Komplexe. Weil man den Profi-Models ihre Schönheit verzeiht, weil es ihr Beruf ist und man sich vorstellen kann, wie sie dafür darben müssen. Den Frauen, die einfach so schön und erfolgreich sind, einfach so aus sich heraus, und mit denen man sich direkt vergleichen kann, denen verzeiht man es nicht. Irgendwann gab es dann wieder ausschließlich Profi-Models in der Brigitte.
Ein Leben im Social Net zu inszenieren ist harte Arbeit
Und so ähnlich ergeht es mir, wenn ich mich durch Instagram scrolle und durch die Timelines und Blogs und mich dabei frage, wie viel Arbeit wohl dahinter steckt und immer wieder darüber staune, wie man es schafft, diese Ausschnitte und Momentaufnahmen aus dem Leben so perfekt zu inszenieren. Ich staune und bin zugegebenermaßen auch ein wenig neidisch, weil ich eben keine Zeit habe, ständig selber Eiscreme zu machen und dann dekoriert mit gefrosteten Beeren auf einem coolen karierten Tuch auf dem stylischen weiß-gebeizten Tisch zu fotografieren. Weil ich es nicht hinbekomme so zwischen Geldverdienen, Kinder aus der Kita abholen, Spielplatz-Dates und banalen Supermarkt-Einkäufen mal eben die supertolle neue Deko fürs Wohnzimmer aus alten Papierresten zu zaubern oder die aktuellen Vorbereitungen für den Motto-Geburtstag zu dokumentieren. In Pastellfarben, versteht sich.
Aber ich gucke es mir unglaublich gerne an, weswegen ich auf Instagram auch weitaus mehr Accounts folge als ich selbst Follower habe. Ich kneif mich dann halt immer in die Nase und denke mir: So what. Am Ende des Tages gefällt mir meine Timeline, die zwar nicht pastellfarben ist, aber dafür viele Blautöne enthält, weil ich mich so viel in den Bergen und am See herumtreibe (wer übrigens mal gucken möchte: allesinklein auf Instagram).
Und da liegt dann vermutlich auch die Lösung. Sich daran freuen, wenn es etwas Schönes gibt. Aber nicht zu vergessen, dass die Realität vielleicht ganz anders aussieht. Sich auf sich selbst zu besinnen. Nicht zu sehr nach den anderen zu schielen. Die digitale Welt eröffnet uns neue Wege der Kommunikation. Sie rückt so vieles so viel näher an uns heran. Gutes wie Schlechtes. Wenn man darüber nicht vergisst, seinen Kopf einzuschalten, dann ist das eine Welt, die sehr viel Spaß machen kann.
Der Anfang von allem. Am Ende des Posts.
Vor mehr als zehn Jahren saß ich in einem Haus in West Hollywood, Los Angeles, in dem ich ein Jahr zuvor sechs wunderbare, aufregende Monate verbracht hatte. Ich war wieder zu Besuch und mein Herz war ein bisschen schwer, weil ich so viele wunderbare Menschen kennengelernt hatte, und die wieder zu verlassen, war nicht einfach. Da sagte jemand zu mir: Bist du eigentlich auf Facebook? Und ich so: Hmm… Facebook? Was ist das? Fünf Minuten später hatte ich einen Facebook-Account und all die Leute dort, die ich viel zu selten sehe, jetzt mit den Kindern ohnehin, sind immer noch in meiner Freundesliste. Ich sehe ihre Kinder aufwachsen, sehe wie sie mittlerweile leben, was sie tun. Das ist für mich die eigentliche Essenz von Social Media.
Seit diesem Tag irgendwann im Frühjahr 2005 hat sich viel verändert. Die Welt ist eine andere geworden. Die digitale ohnehin, sie dreht sich so schnell weiter, dass einem schwindlig werden kann. Aber so lange ich weiß, warum ich mich damals angemeldet habe, ist noch nicht alles verloren zwischen uns, liebes Facebook.
PS Zu dem Thema habe ich vor mehr als zwei Jahren schon mal gebloggt: Wie mich die fiesen Kommentare in den Onlinemedien damals schon nervten, kann man im damaligen Post zum Digitalen Müll nochmal nachlesen. Geändert hat sich wohl nicht so viel. Und meine Idee mit Digital Detox hat auch nie funktioniert :-)
Und, wie seid ihr denn so am Start in der digitalen Welt? Macht ihr da mit? Erzählt doch mal! Auf jeden Fall lest ihr Blogs, meinen zum Beispiel. Und das sogar bis zum Ende. LOL.

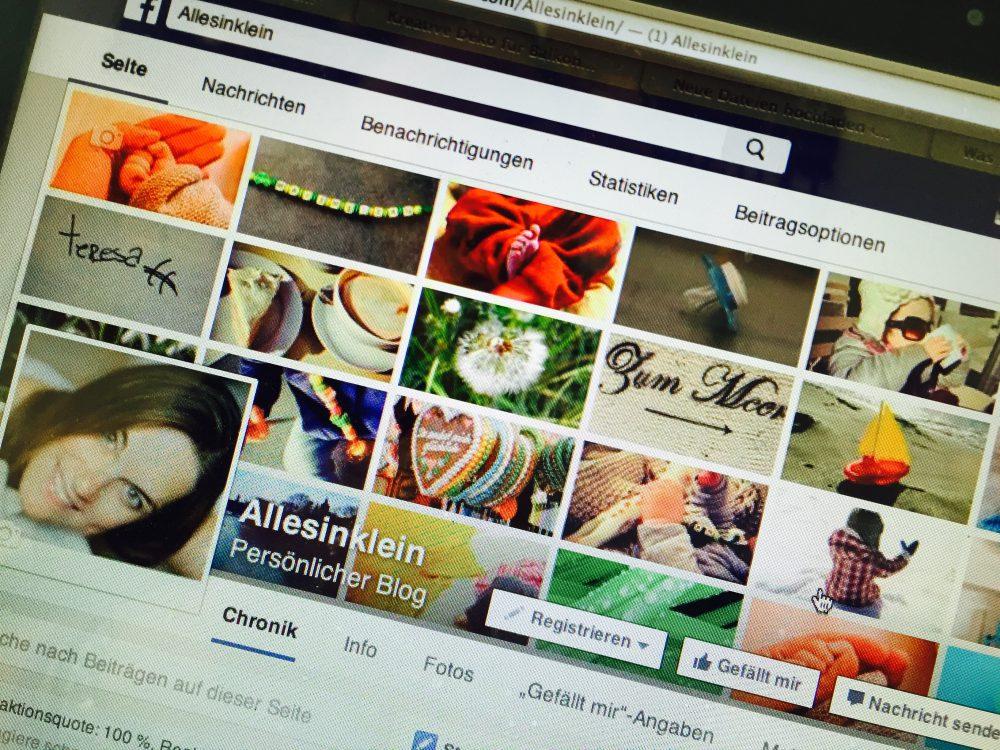










3 comments
In sehr vielen Stellen deines Textes konnte ich mich wiederfinden. Ich hatte 2000 meine erste Website bei beepworld und bis auf cutenews wohl die meisten Systeme, die seither so genutzt wurden, irgendwie auch mal gestreift. Bei Social Media war ich mit Ausnahme von MySpace auch so ziemlich überall dabei. Aber für mich war das www immer ein Ort, an dem ich etwas von mir ausdrücken konnte, das im realen Leben keinen Platz hatte. Etwas dünkleres. Manchmal war es auch ein Ort, mich an die schönen Dinge vor der Nase zu erinnern, die ich vielleicht sonst nicht immer gesehen hätte. Aber es ist ein Ort der Ehrlichkeit für mich, weswegen ich mit der pastelligen Entwicklung nicht so ganz konform gehe und mir recht schwer tue damit. Es passiert mir immer öfter, dass ich im Rahmen des Internets an die ‚guten alten Zeiten‘ denke. Es verändert sich, aber ich weiß nicht, ob ich die derzeitige Veränderung genauso mitmachen werde wie die vorangegangenen.
Liebe Paleica, dankeschön für deinen Kommentar! Es ist wohl das Wesen des Internets, dass es sich einfach beständig ändert. Das macht es ja auch so spannend. Ich habe die Tage auf einem Fashion-Blog eine ganz spannende Diskussion rund um Instagram mitverfolgt. Irgendwie wird das langsam auch ein bisschen krank, diese Selbstinszenierung. Und ich wette, dass man sich irgendwann an den Pastellfarben und den ganzen überbelichteten Bildern auch mal statt gesehen hat. Ich freu mich übrigens, dass ich jetzt deinen Blog entdeckt habe, den mag ich gern! :-) Alles Liebe, Petra
ich gehe eigentlich auch davon aus, dass dieser hype nicht ewig anhalten wird. im grunde werden die stimmen dagegen ja auch immer lauter. andererseits kommt es mir ein bisschen wie der virtuelle spiegel der offline model- und fashionwelt vor und auch wenn da seit jahrzehnten die wogen immer wieder hochgehen, bleibt es doch beim hochglanz. naja, wir werden es alle sehen ^.^
das freut mich sehr zu hören, ich freue mich immer über eine/n neue/n mitleser/in :)